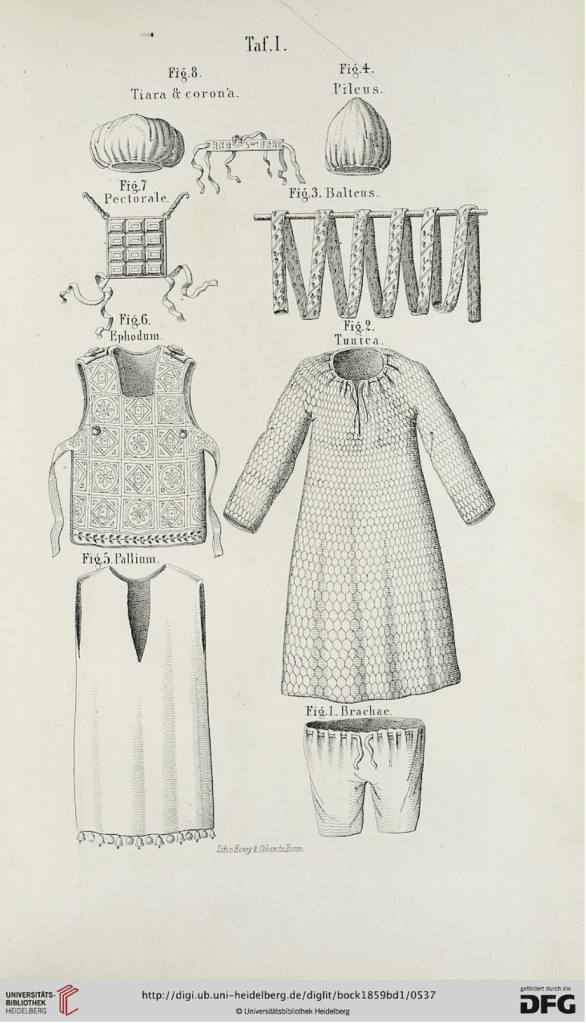Mein schwarzes Schälmesser trennte die dünne Schale vom frisch erworbenen Ingwer. Die Knolle dieses besonderen Gewächses, das seit Jahrhunderten als Gewürz und Arznei Verwendung findet, stammte aus dem fränkischen Knoblauchsland und hatte nicht, wie die meisten Ingwerknollen einen meilenweiten Weg hinter sich. Lokal. Frisch. Gesund. Einen Ingwer-Shot hatte ich heute sehr nötig, um die in mir aufsteigende Übelkeit an diesem Sonntagmorgen zu bekämpfen.
Flutkatastrophe in Valencia, Spanien.
Bevorstehende US-Wahlen voller Streit und Entzweiung.
Eine zerrissene deutsche Politik.
Krieg in der Ukraine.
Nordkoreanische Truppen in Russland.
Krieg im Heiligen Land.
Moldaus Ringen um Demokratie.
Machtkampf in Bolivien.
Beim Hören der Nachrichten war mir schlecht geworden. Trotz des strahlenden Novembermorgens hatten sich trübe Gedanken in den Vordergrund geschlichen. An der Hoffnung an solch einem Morgen festzuhalten, war gar nicht so einfach. Die Nachrichten überfluteten meine Gedanken und machten einem grollenden Bauchweh Platz.
Ich schnitt den geschälten Ingwer in kleine Stücke, ließ sie in den Zerkleinerer fallen und zerkleinerte das Ganze mit Zitronensaft und Honig angereichert zu einem dickflüssigen Getränk.

Die Gemüsebetriebe, die diesen Ingwer erfolgreich im Nürnberger Knoblauchsland angebaut hatten, hatten die Hoffnung nicht aufgegeben. Trotz spürbaren Klimawandel und massiven Herausforderungen stellten sie sich den neuen Gegebenheiten. Eigentlich wäre es so leicht, die Hände in den Schoß zu legen und nach einer Betriebsamkeit voller Tradition alles aufzugeben, weil die seit langem gewohnten Gemüsesorten nicht mehr oder schlechter reifen, die Energiepreise massiv angestiegen und Fachkräfte nur schwer zu finden waren. Aber sechzehn landwirtschaftliche Betriebe aus dem Nürnberger Norden gehen andere, innovative Wege, denn Gemüseanbau ist ihre Berufung. Ein aktiver und bewusster Schritt, der das Gewohnte an vielen Stellen verlässt, um neue Wege zu finden, die in die Zukunft weisen. Innovation gekoppelt mit Exnovation („Aktives Aufhören einer Tätigkeit“).



Eine exnovierende Grundhaltung hilft, das System auszumisten und dadurch handlungsfähig zu bleiben.
Bils/Töpfer: Exnovation und Innovation, S. 137.
Loslassen macht Platz für Neues. Dieser Prozess setzt die notwendige Energie frei, die Hoffnung und Mut für Gegenwart und Zukunft schenkt. Das zeigen die neuesten Studien zu systemischen Management. Der fränkische Ingwer ist ein solches hoffnungsvolles Produkt im Angesicht massiver Veränderungen, die wir uns alle nicht wünschen, aber in bitterer Weise unumgänglich sind. Der fränkische Ingwer ist umweltfreundlicher, frischer und bekömmlicher als jeglicher Ingwer aus Fernost, der tausende von Transportkilometern und so manches nicht kontrollierbares Spritzmittel mit im Gepäck hat.
Mich hat der Nürnberger Ingwer angesichts der Herausforderungen in Kirche sehr nachdenklich gemacht, denn auch die Kirchen stehen vor großen Herausforderungen. Der sonntägliche Gottesdienst wird zunehmend weniger besucht, die Mitgliedszahlen sind massiv am sinken und selbst zentrale Angebote stehen vielleicht schon bald aufgrund fehlender finanzieller Mittel auf dem Prüfstand. Was können wir als Kirche der Gesellschaft anbieten, das zeitgemäß und gleichzeitig relevant ist?
Was also können wir im kirchlichen Bereich an Exnovationen vornehmen, damit eine Gegenwart und Zukunft möglich wird? Sandra Bils schreibt weiter:
Im kirchlichen Bereich könnte sie [die Exnovation] unterstützen, dem traditionellen Erbe gerecht zu werden, indem durch Läuterungsprozesse eine gewisse Patina an Folklore und Gewohnheit kritisch hinterfragt wird und dadurch eine spezifischere Profilierung möglich wäre. Die zusätzlich damit einhergehende Ressourcenersparnis wird in den anstehenden Veränderungsprozessen dringend benötigt. (Bils, ebd.)
Unser Erbe und kostbare Verantwortung als Kirche liegt tief im Evangelium Jesu Christi verankert, das hoffnungsvoll durch Tod und Auferstehung über sich hinausweist. Ich würde es als das wunderbar trotzige Prinzip Hoffnung bezeichnen, das wir leben und anderen schenken können. 117 mal kommt „Hoffnung“ in der Bibel vor. Es gibt eine diesseitige, aber auch eine über das irdische Leben hinausragende Hoffnung, die in den Schmerzen der Zeit über die gegenwärtige Situation hinausweist. Wahlen. Kriege. Streit. Zwist. Sie alle werden nicht das letzte Wort haben, sagt uns der christliche Glaube.
Darum sollten wir als Kirchen eben nicht aufgeben oder die Situation eines Rückganges einfach resigniert annehmen, sondern wie die Gemüseanbaubetriebe des fränkischen Knoblauchslandes uns auf unsere Berufung konzentrieren und neue Wege suchen. Für mich ist dies das wunderbar trotzige Prinzip Hoffnung, das uns durch Jesus Christus geschenkt wurde, das wir weitergeben und durch Wort und Tat weiterschenken können. Darum:
Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat.
Heb 10,23
Die Gemüsebauer im Knoblauchsland halten an ihrer Berufung zum Gemüseanbau fest, der eine Region stärken und gesund nähren soll. Wir als Kirche sollten an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Auch oder gerade im Angesicht massiver Veränderungen, in denen wir so manches vielleicht Liebgewonnenes oder traditionell Gewohntes hinter uns lassen müssen. Bleibt für mich die Frage: Was könnte für uns als Kirche der scharfe, gesundmachende Ingwer als Vehikel unserer Kernbotschaft sein, den wir anbauen, ernten und weitergeben? Das kann wohl nur jeweils lokal entschieden werden. Was dem Knoblauchsland der ungewohnt neue Ingwer ist, mag im Bamberger Zwiebelland etwas ganz anderes, vielleicht die Süßkartoffel (?) sein. Was durch die MUT-Projekte im Münchner Raum der Flughafen Chor ist, mag im Dekanat Naila „OVERFLOW – die junge Kirche im Frankenwald“ sein.
Ein erster Schluck des Ingwer-Shots ran in meiner Kehle süß und scharf hinunter. Im Nu war mein von Bauchweh geplagter Leib von einem wohlig warmen Gefühl erfüllt. Gedankt sei es dem wunderbar trotzigen Prinzip Hoffnung.


Unbedingte Literaturempfehlung:
Sandra Bils und Gudrun Töpfer: Exnovation und Innovation: Synergie von Ende und Anfang in Veränderungen (Systemisches Management)