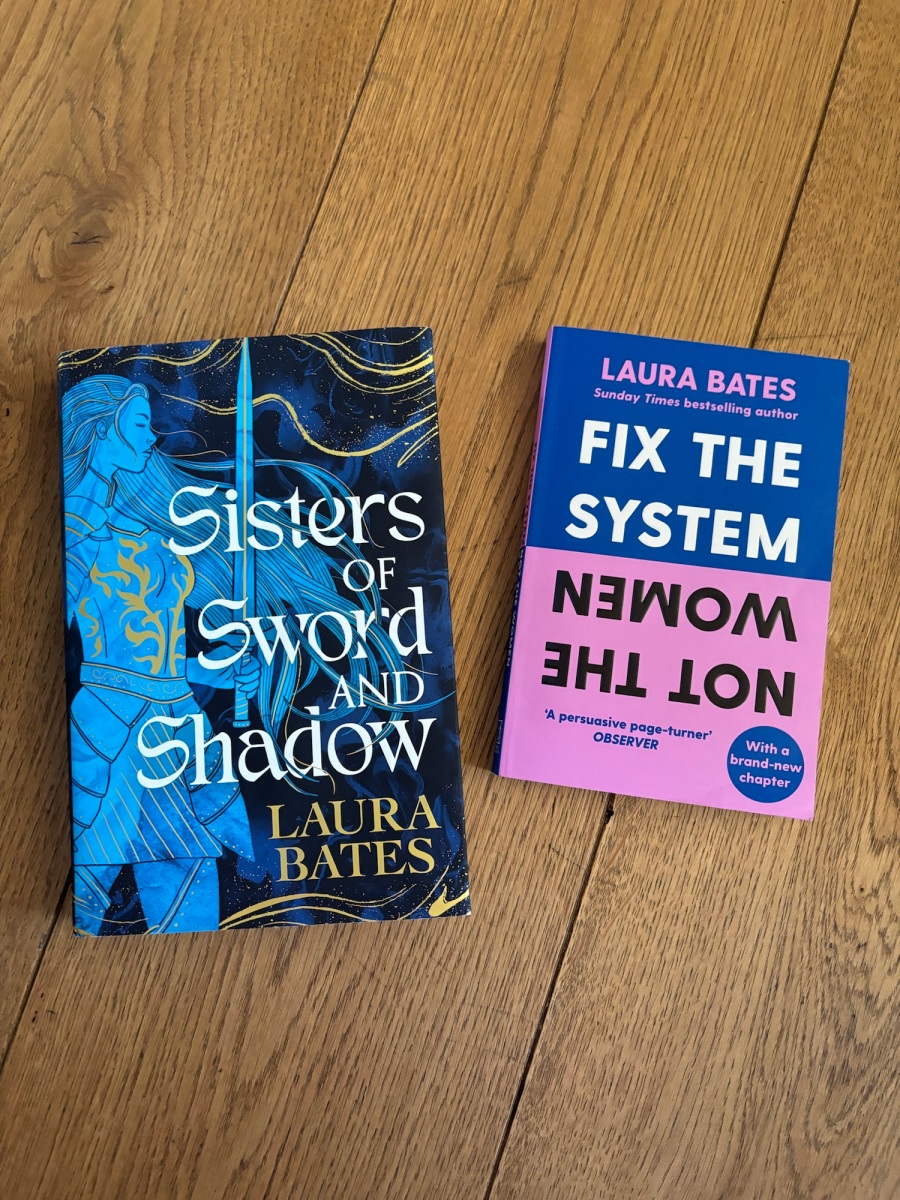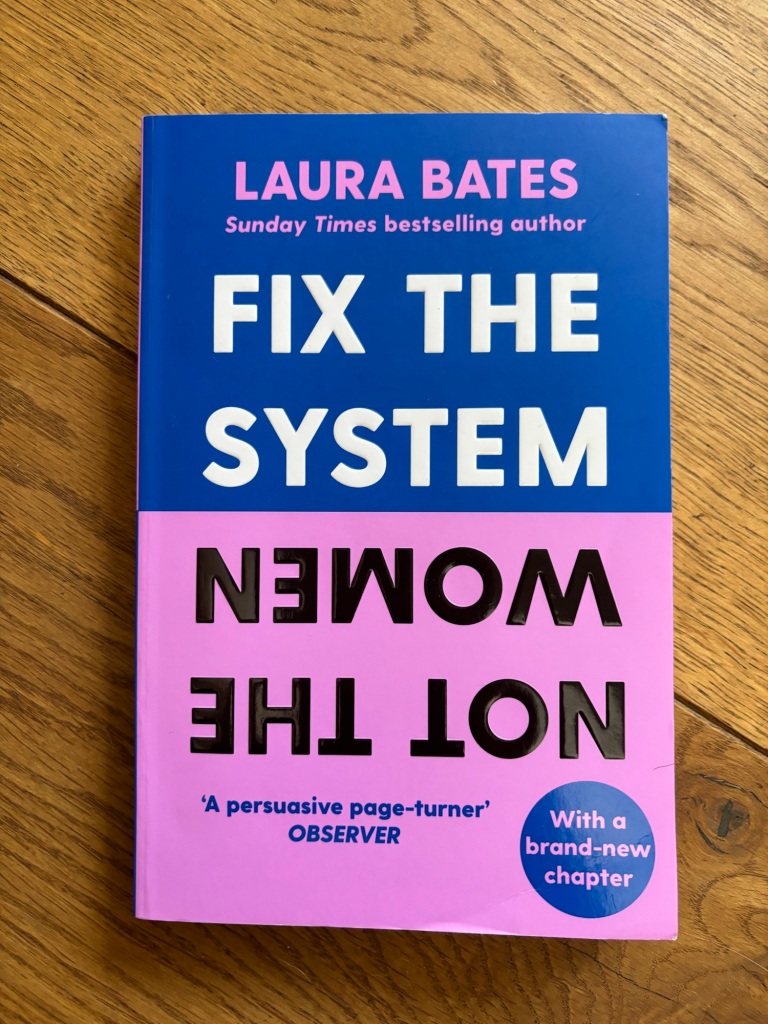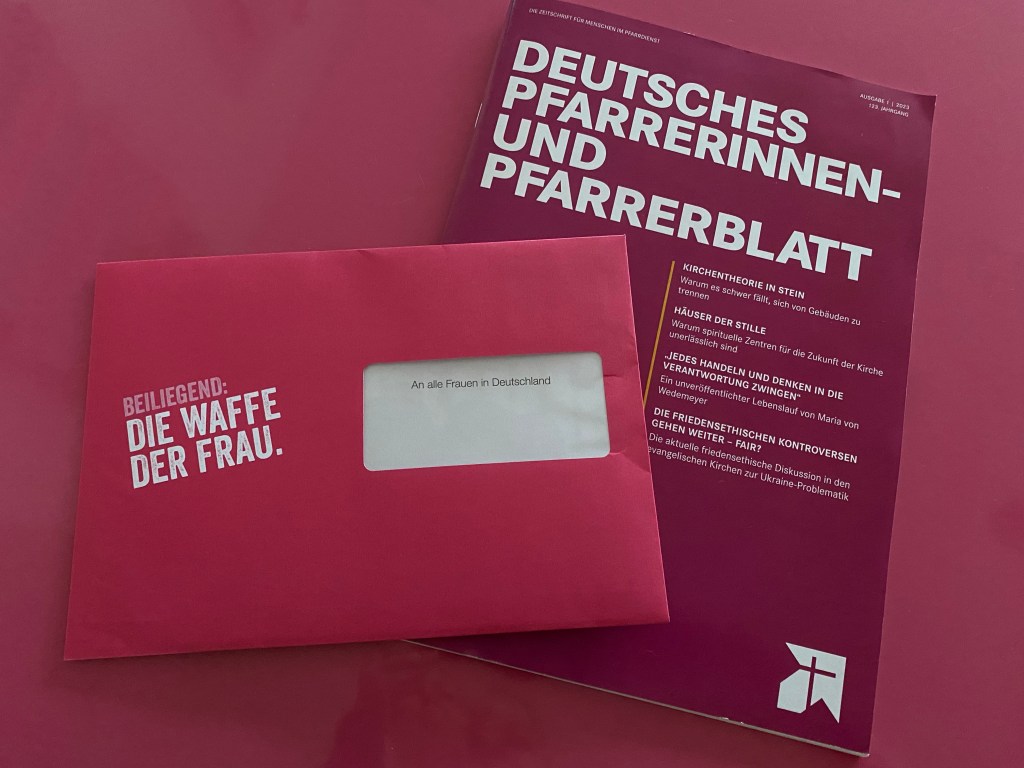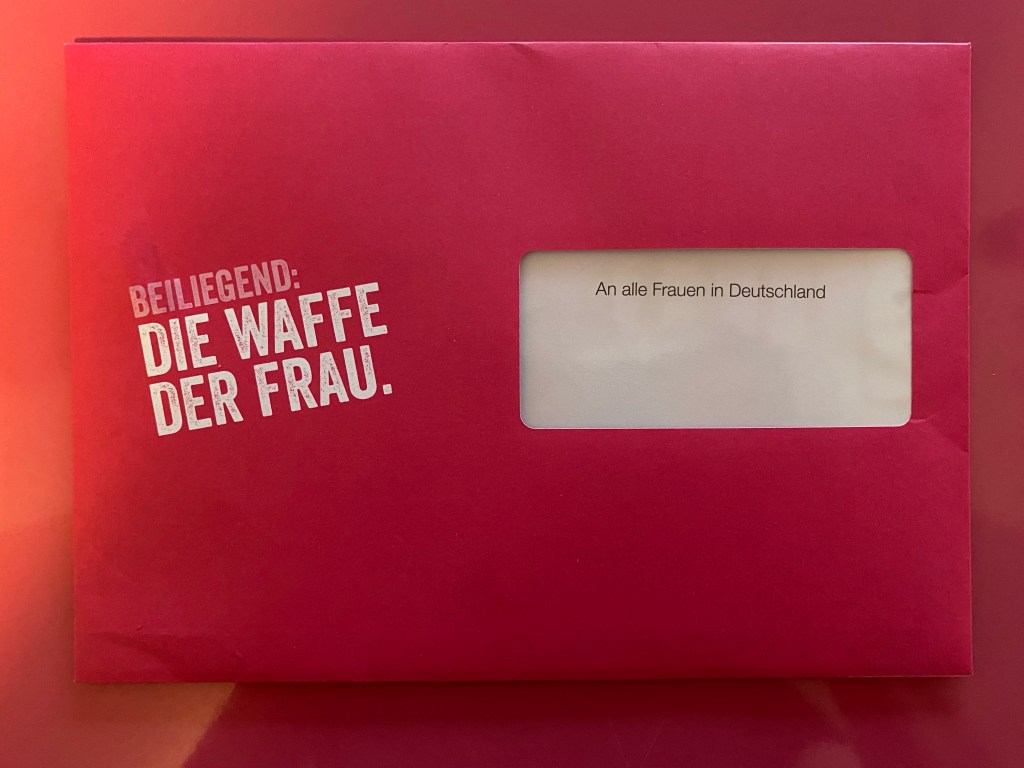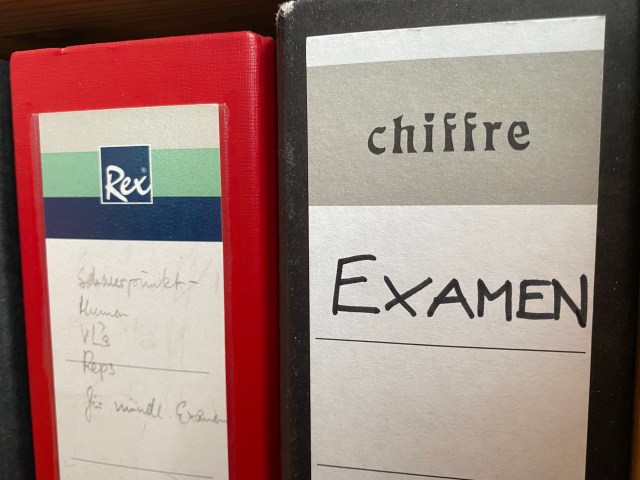Meine Hand griff magisch angezogen in das gut gefüllte Regal und zog eine lila Seife aus der Reihe der Seifenarmee. Als ich den von ihr ausgehenden Duft des Lavendels einsog, schloss ich unwillkürlich die Augen und wurde durch den Nebel der Erinnerung in meine Kindheit zurückversetzt.


Eine kleine, zart gebaute Frau mit einem Dutt aus lichtem, weißen Haar öffnete die Tür zum schmalen Zugang des kleinen, unscheinbaren Hauses an der Stadtmauer und nahm mich herzlich in die Arme. Ein schlichtes Wohnzimmer mit Küche, am Fenster der Arbeitsbereich eines Schuhmachers. Eine enge, knarzende Treppe führte zum elterlichen Schlafzimmer und einem kleinen Kinderzimmer hinauf. In jeder Schublade lag ein kostbares Stück Lavendelseife, das beim Öffnen einen Wohlgeruch verströmte.
Aus dem Nebel der Erinnerung war mir meine Urgroßmutter plötzlich wieder so nah, obwohl sie vor über dreißig Jahren verstorben war. Der Duft des Lavendels, vor allem der Lavendelseife, ist für mich unwiderruflich mit ihr verbunden, wenn auch meine Erinnerung im Nebel der Zeit nur ab und an wie ein verstecktes Objekt aus dem Dunst meiner Gedanken auftaucht.
Frauen wie ihr haben wir nachfolgenden Generationen es zu verdanken, dass Gleichberechtigung einen Fortschritt gemacht hat. Noch befinden wir uns mitten in einem Ringen um ein Leben auf Augenhöhe, aber ohne die Kraft, den Schweiß und auch die Tränen vieler Frauen vor uns hätten die nachfolgenden Töchter nie die Möglichkeiten erhalten, von der jene nur hätten träumen können.
Von mehr Möglichkeiten, von Entfaltung und Unabhängigkeit träumte auch die Schriftstellerin Virginia Woolf, die achtzehn Jahre vor meiner Urgroßmutter 1882 in London geboren worden war. Während meine Urgroßmutter in ärmliche Bedingungen in Franken geboren war und als Magd vor ihrer Hochzeit in einem Haushalt gearbeitet hatte, war die „Vorreiterin des Feminismus“ in eine wohlhabende Londoner Familie hineingeboren. Schon früh war sie aufgrund ihres Elternhauses von berühmten Autoren umgeben gewesen und war daher in jungen Jahren zum Schreiben gelangt. In dem 1929 veröffentlichen Essay „A Room of One’s Own“ schrieb Woolf über die eingeschränkten Möglichkeiten weiblicher Schriftstellerinnen und avancierte so zu einer frühen Kämpferin für die Gleichberechtigung von Frauen.
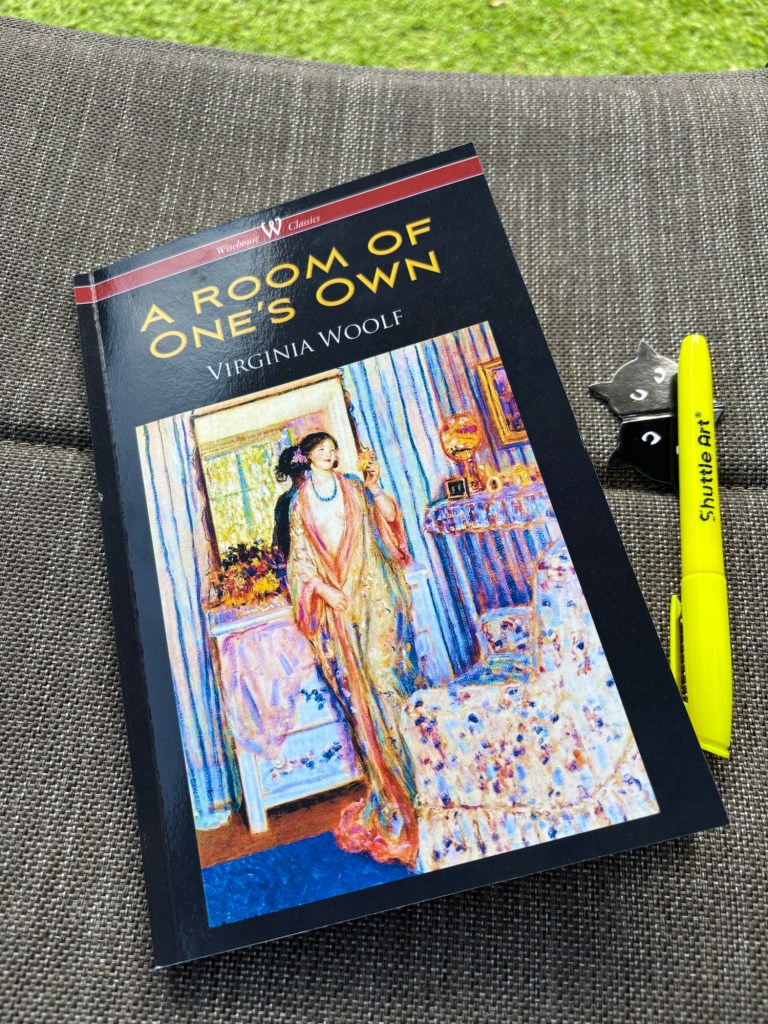
Als ich nach meinem Besuch des Drogeriemarktes – der Duft des Lavendels begleitete mich immer noch in Gedanken – den erwähnten Essay, den ich schon lange vor gehabt hatte zu lesen, zur Hand nahm, staunte ich nicht schlecht. Hier schrieb Virginia Woolf:
Intellectual freedom depends upon material things. Poetry depends upon intellectual freedom. And women have always been poor, not for two hundred years merely, but from the beginning of time. Women have had less intellectual freedom than the sons of Athenian slaves. Women, then, have not had a dog’s chance of writing poetry. That is why I have laid so much stress on money and a room of one’s own. However, thanks to the toils of those obscure women in the past, of whom I wish we knew more, thanks, curiously enough to two wars, the Crimean which let Florence Nightingale out of her drawing-room, and the European War which opened the doors to the average woman some sixty years later, these evils are in the way to be bettered.
Woolf, Virginia: A room of ones own, Schweden: Wisehouse Classics, 2018, p. 67.
Intellektuelle Freiheit hängt von materiellen Dingen ab. Dichtung hängt von intellektueller Freiheit ab. Und Frauen sind immer arm gewesen, nicht nur seit zweihundert Jahren, sondern seit aller Zeiten anfang. Frauen hatten weniger intellektuelle Freiheit als die Söhne der Sklaven aus Athen. Frauen haben also nicht die geringste Chance gehabt, Gedichte zu schreiben. Deshalb habe ich so viel Nachdruck auf Geld und ein Zimmer für sich allein gelegt. Aber dank der Mühsal jener undeutlichen Frauen in der Vergangenheit, von denen ich wünschte, dass wir mehr über sie wüssten, seltsamerweise auch dank zweier Weltkriege, des Krimkriegs, der Florence Nightingale aus ihrem Wohnzimmer entliess und des Ersten Weltkriegs, der etwa sechzig Jahre später den Durchschnittsfrauen die Türen öffnete, sind diese übel auf dem Wege der Besserung.
In diesem Textauszug des berühmten Essays berichtet Woolf von der Mühsal der Frauen, die über Generationen klein gehalten und eingeschränkt wurden. Deren jeweiligen Engagement ist es zu verdanken, dass Emanzipation Stück um Stück Wirklichkeit wird.
Bei dem Verweis auf diese Frauen hat Woolf das englische Adjektiv „obscure“ verwendet, das im Deutschen mit „obskur“, aber auch „vernebelt“ oder „undeutlich“ übersetzt werden. Aufgrund des Textzusammenhanges habe ich dies in meiner Übersetzung mit letzterwähnten Adjektiv wiedergegeben. Woolf geht in ihrem Text ein interessantes literarisches Spiel mit Obskurität / Verneblung / Vergangenheit ein. Denn: Nicht selten liegt die Vergangenheit wie ein Nebel hinter uns.
Ab und an treten „undeutliche“ Frauen wie meine Urgroßmutter aus dem Nebel der Vergangenheit hervor. Dabei wird mir dann immer wieder klar, wie viele Entbehrungen, welche Leidensfähigkeit, Selbstaufgabe und Engagement sie und andere Frauen aufwiesen, damit ich heute die sein darf, die ich gegenwärtig bin.
Dabei denke ich an die Vorbilder, die meine eigene Biografie beeinflussten. Immer wieder treten sie an der einen oder anderen Stelle inspirierend aus dem Nebel meiner Gedanken hervor. Ihr Wirken hat mich auf unterschiedlichen Ebenen geprägt – privat, beruflich und ideell. Einige seien hier stellvertretend für viele starke Frauengenannt, die in meinem Leben wirkten:
Meine Urgroßmutter kümmerte sich um ihre einzige Tochter, die ein liebevolles Zuhause, Bildungschancen und ein Gesangsstipendium erhielt. Leider wurde dieses aufgrund des zweiten Weltrkrieges hinfällig und ihr Traumberuf dadurch unerreichbar.
Meine Schwiegermutter, die die Verwirklichung ihrer eigenen beruflichen Biografie hinten anstellte und meinen Mann zu einem Ehemann aufzog, der Frauen nicht nur als gleichberechtigt schätzt, sondern meiner Berufung als Kirchenfrau den Vorrang gab.
Meine Mentorin Andrea Rößler, deren Liebe für Unterricht im Vikariat auf mich abfärbte und mir nach einer Phase im „klassischen“ Pfarramt meine gegenwärtige Ausrichtung in der Ausbildung schenkte. Nicht nur im Rahmen der Bundespolizei, sondern seit einigen Monaten als Rektorin des Evangelischen Studienseminars für Pfarrausbildung (ESP) in Bayern und Sachsen.
Regionalbischöfin i.R. Susanne Breit-Keßler, die ich bei Hospitationen begleiten durfte und dadurch wertwolle Einblicke in Tätigkeit, Freude, aber auch Herausforderung einer Regionalbischöfin erhielt.
Generalkonsulin i.R. Brita Wagener, die ich in meiner Zeit in New York kennenlernen und deren Weitblick, Engagement und Standfestigkeit im politischen Kontext der Vereinten Nationen, New Yorks und der USA mich tief beeindruckt hat.
Als ich am Abend an der Ablage zur Küche vorbeilief, fiel mein Blick auf die gekaufte Lavendelseife, die vor einigen Stunden von mir aus der duftenden Seifenarmee des Drogeriemarktes herausgelöst und mitgenommen worden war. Nun lag sie etwas verloren da. Ich nahm sie vorsichtig in beide Hände, sog den vollblumigen Geruch des Lavendels ein, der eine Flut von Dankbarkeit über diese und andere besondere Frauen meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auslöste. Und wer weiß, vielleicht würde auch ich irgendwann für eine andere Frau aus dem Nebel ihrer eigenen Gedanken als eine hervortreten, die sich für sie und Gleichberechtigung einsetzte? Ich lächelte still vor mich hin, während ich die Seife in eine noch nicht duftende Wäscheschublade legte, die hoffentlich irgendwann den Duft des Lavendels und dankbarer Erinnerungen haben würde.