„Wo wohnt deine Sehnsucht?“
Ich sah sprachlos auf die kleine Karte, die mir am Anfang des Gottesdienstes der evangelisch-reformierten Kirche in Erlangen mitsamt Gesangbücher und Gottesdienstblatt überreicht worden war. Die abgebildeten Berge umsäumt von einem blauen Himmel, luden durch die fast mittig platzierte Schaukel zum gedanklichen Innehalten ein.

Ich atmete durch und setzte mich mit meiner Familie statt auf eine Schaukel in die letzte Stuhlreihe des Gemeindesaals, die noch nicht belegt war. Sehnsucht nach der alten reformierten Heimat im fernen Schottland hatte mich zum zweiten Mal in diese Gemeinde gelockt. Doch dass nun der Gottesdienst dieses Thema aufnehmen würde, erstaunte mich sehr.
„Wo wohnt deine Sehnsucht?“
hatte der Schwabacher Pfarrer Dr. Guy M. Clicqué in seiner Predigt die anwesenden Gottesdienstbesucher gefragt. Gerne hätte ich von meinem geistlichen und gemeindlichen Sehnsuchtsort erzählt. Mein Herz schrie stumm immer wieder Orkney, doch als Besucherin behielt ich dies für mich, lauschte stattdessen den Worten des Predigers und ließ mich treiben in der Vertrautheit des reformierten Gottesdienstes.
Als am Nachmittag aus dem Sehnsuchtsort Orkney ein Anruf kam, staunte ich nicht schlecht. Doch die Nachrichten aus meiner alten schottischen Gemeinde waren alles andere als rosig: Während meines Amtsbeginns dort im Jahr 2007 waren es noch sechs ganze Pfarrstellen auf dieser nördlich gelegenen schottischen Inselgruppe gewesen. Nun sollte es nur noch eine Pfarrstelle und eine Gemeinde für die Inselgruppe geben, denn die Church of Scotland befindet sich im freien Fall. Hunderte Kirchen werden in den nächsten Jahren schließen müssen und damit Pfarr- und Gemeindestellen gestrichen (Link: BBC). Die so stolze einstige schottische Nationalkirche, in der ich dank lutherischem und schottisch-reformierten Examen habe arbeiten dürfen und deren Niedergang sich damals nur sehr vage am Horizont als zaghaftes Dämmern abzeichnete, wird schon bald als eine kleine religiöse Minorität existieren.
Was dort innerhalb von nicht einmal zwanzig Jahren geschehen ist, war nicht vorhergesehen und schließlich durch die Corona-Jahre beschleunigt worden – und langsam scheint es auch in meiner eigenen lutherischen Kirche in Bayern in das Bewusstsein zu rücken. Mit Bauchschmerzen beobachte ich schon lange die besorgniserregende Entwicklung der Mitgliedszahlen, die durch eine defizitäre Aufarbeitung der Missbrauchsfälle nun zusätzlich zu den Nachwirkungen der Pandemie beschleunigt wird. Ja, ich mache mir Sorgen. Sorgen um meinen Sehnsuchtsort Orkney, aber auch um meine bayerische Heimatkirche.
Wie nur können wir andere glaubwürdig von einer offenen und willkommen heißenden Kirche überzeugen? Vielleicht ist der Schlüssel hierzu, dass Gemeinden und kirchliche Gruppen ein Sehnsuchtsort sind, an dem Glauben und Himmel den Menschen entgegenkommen, die Gottes Nähe suchen.
Nachdenklich wendete ich die Karte, auf deren Rückseite das Vorderbild nur dezent abgedruckt worden war und hierdurch Platz für die Notierung des eigenen Sehnsuchtsortes geschaffen worden war. Viele weitere Orte fielen mir neben Orkney ein – zwei besondere Hauskreise, mehrere Gemeinden, die in aller Herren Länder mir ein Zuhause gewesen waren, aber auch ganz „weltliche“ Orte wie Carnegie Hall oder das Café meiner Kindheit und Jugend, und so viele mehr.
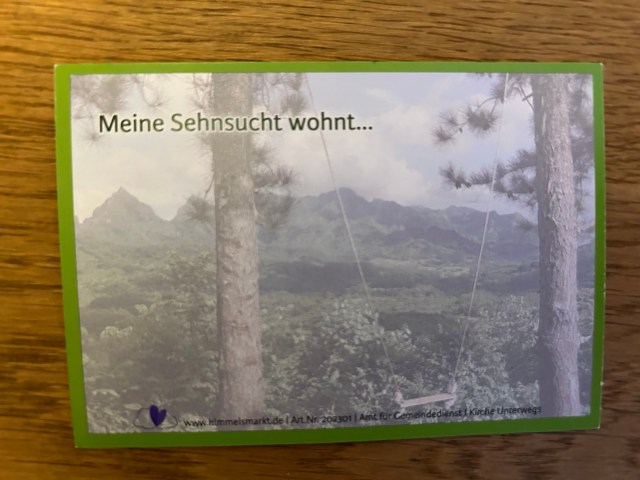
„Wo wohnt deine Sehnsucht?“, lieber Leser, liebe Leserin. Eine kleine Inspiration hierfür kann das Lied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ sein, das die englische Komponistin Anne Quigley 1973 schrieb und wir selbstverständlich im Gottesdienst sangen. Ich freue mich, entweder per Email oder anhand dieser Umfrage von Ihnen zu hören.



