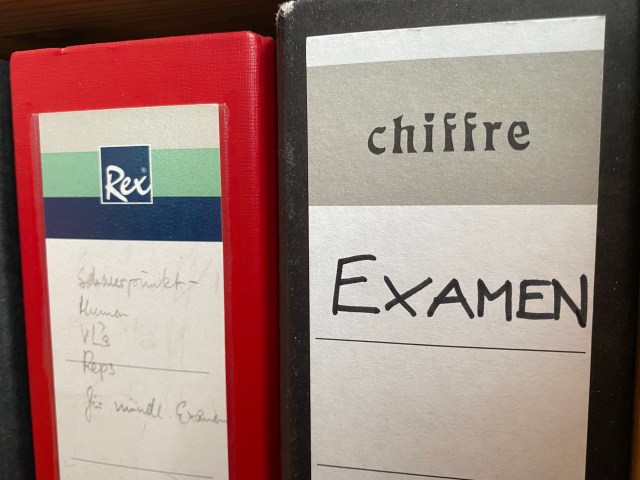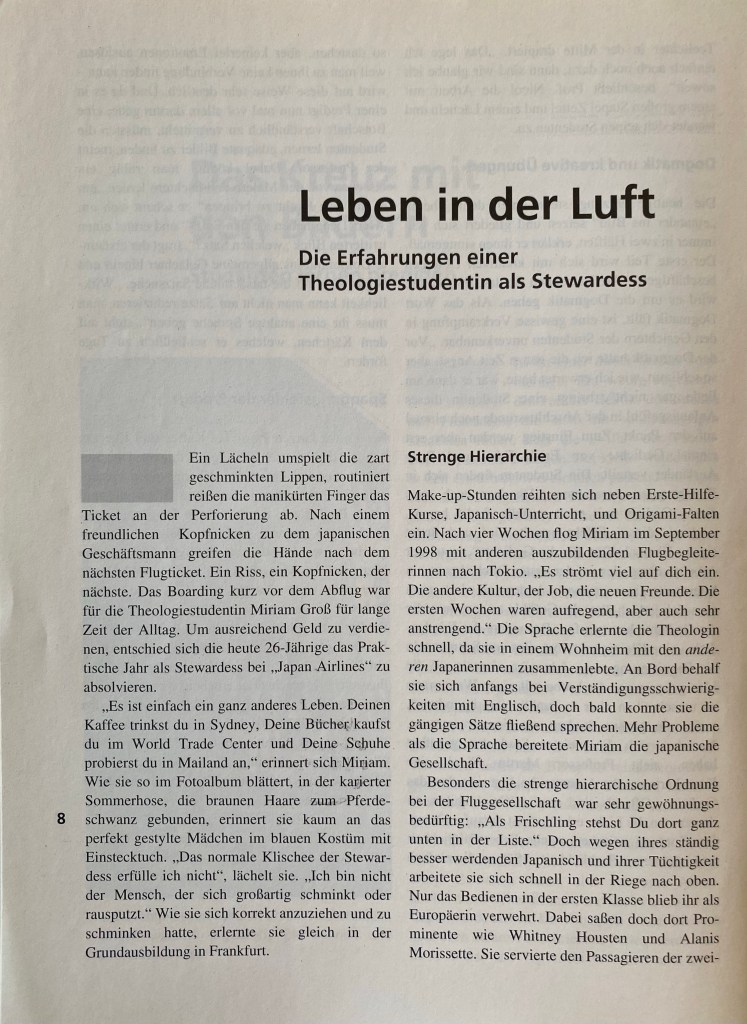Das Jahr 2022 geht zu Ende. Wie sicherlich Millionen andere Menschen, gönne ich mir die Zeit zur Rückschau. Das fast vergangene Jahr zu würdigen ist für mich wie ein kleiner Abschluss dessen was war, und macht mich bereit für das Neue, das vielleicht kommen wird.
2022 war ein sehr durchwachsenes Jahr. Das erlebte Spektrum der zwölf Monate des fast vergangenen Jahres hat mich kaum zu Atem kommen lassen.
Faszinierende Höhen erleben und dunkle Tiefen meistern,
wunderbare Erfahrungen machen und tiefe Verletzungen überdauern,
neue Freunde gewinnen und liebe Menschen verlieren,
Glücksmomente auskosten und schmerzhafte Enttäuschungen verarbeiten,
nie geahnte Leistungen vollbringen und gesundheitliche Herausforderungen schultern,
geschenkte Liebe dankbar entgegennehmen und erlebten Haß stehen lassen…
All diese Geschenke und Herausforderungen des fast vergangenen Jahres seien in Gottes gute Hände zurück gelegt. Möge er alles zum Segen werden lassen.
Gebet am Altjahresabend
Pfarrerin Miriam Groß
Was wird 23 bringen? Über die Bedeutung der Zahl haben sich viele den Kopf zerbrochen.
23 ist ungerade und eine Primzahl.
Der Biorhythmus nach Swoboda/Fließ wiederholt sich alle 23 Tage.
Ein einfacher menschlicher Chromosomensatz besteht aus 23 Chromosomen.
Den Spekulationen möchte ich in meinem Blog keinen Raum einräumen. Doch tröstlich fündig bezüglich der neuen Jahreszahl wurde ich in der Bibel: Psalm 23 ist ein wunderschöner Glaubenstext, der von großem Vertrauen in Gott spricht. Die Worte haben viele Generationen getragen. Für mich steht dieses kommende Jahr unter dem Motto dieses Psalms. Aus eigener Erfahrung schätze ich die tiefe Weisheit der Worte, die in meinem Leben schon oft eine große Relevanz hatten.
Zum Jahreswechsel möchte ich euch angelehnt an Psalm 23 einen kleinen Segenswunsch weitergeben.
Ich danke euch, allen Leserinnen und Lesern meines kleinen Blogs, dass ihr meinen Worten und Gedanken Raum und Zeit geschenkt habt. Möge Gottes Segen euch in 2023 begleiten!
Eure Miriam Groß
Der HERR ist mein Hirte, Möge der HERR in diesem Jahr mit dir sein,
mir wird nichts mangeln. damit du nicht darben musst.
Er weidet mich auf einer grünen Aue Möge er für dich sorgen
und führet mich zum frischen Wasser. und dir alles Notwendige zukommen lassen.
Er erquicket meine Seele. Möge er deine Seele nähren.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Möge er dich auf rechtem Weg führen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, Und solltest du durch dunkle Zeiten gehen.
fürchte ich kein Unglück; wünsche ich dir, dass du furchtlos bist;
denn du bist bei mir, denn Gott wird mit dir sein,
dein Stecken und Stab trösten mich. denn er wird dich leiten und bewahren.
Du bereitest vor mir einen Tisch Er möge für dich sorgen –
im Angesicht meiner Feinde. gerade dann, wenn Menschen es schlecht mit dir meinen.
Du salbest mein Haupt mit Öl Möge dir Gutes entgegenkommen
und schenkest mir voll ein. und mögest du ab und an Überfluss an Schönem erleben.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, Dein ganzes Leben sollst du wissen, dass du gesegnet bist,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. damit du dich traust, im Glauben Wurzeln zu schlagen.
Pfarrerin Miriam Groß

Anbei ein kleines Grußvideo mit Segenswunsch zum neuen Jahr: