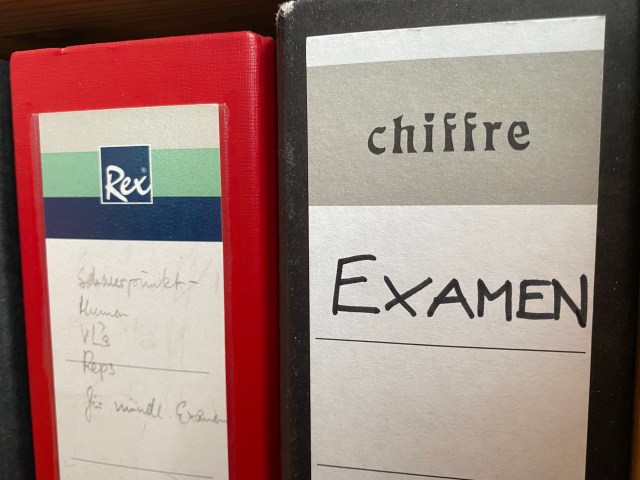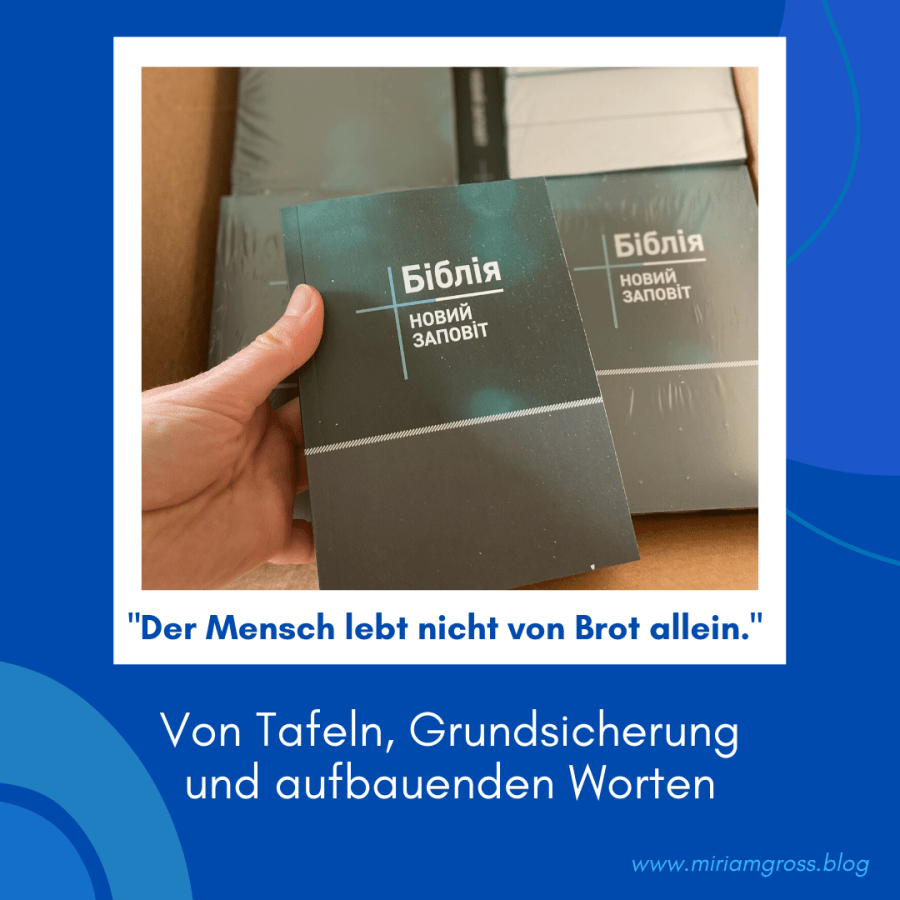Mein Blick war vor Müdigkeit noch ganz verschwommen. Ich setzte in der Dunkelheit einen Fuß vor den anderen während meine Lehrgruppe um kurz vor fünf Uhr in einem gleichmäßigen, schweigenden Rhythmus vom dumpfen Stapfen der Dienststiefel angetrieben durch die kalte Winternacht marschierte. Um diese Uhrzeit würde ich mich normalerweise noch einmal umdrehen, mich in die wohlig warme Daunendecke wickeln und eine weitere Stunde schlafen, bevor mein Tag und kurz danach mein Dienst als Polizeiseelsorgerin beginnen würde.
Aber Jesus sagte einst in den berühmten Worten der Bergpredigt (Mt 5,41): „Geh die Extrameile mit!“ Ich seufzte beim Gedanken an einen warmen Kaffee leise und lief in der Dunkelheit stoisch weiter.

Kurze Zeit später hielt die Lehrgruppe umgeben von dunklen fränkischen Wäldern an während die angehenden Kollegen, die mit dem Finden des Weges betraut worden waren, über eine Karte gebeugt und im Schein von Taschenlampen den besten Weg zum Zielort eruierten. Sie würden in dieser Nacht viele Meilen bzw. Kilometer als Teil ihrer Ausbildung durch die Dunkelheit gehen.

Die Extrameile.
Nächtliche Alarmübungen sind ein wichtiger Bestandteil des ersten Ausbildungsjahres in der Bundespolizei. Bei einer solchen Übung müssen sie als Lehrgruppe Durchhaltevermögen, Orientierungssinn und Kameradschaft und die aufgetragenen Extrameilen gemeinsam bezwingen.
Das Wörterbuch von Pons definiert diesen Ausdruck in folgender Weise:
„Die Extrameile gehen“, Jargon (Anglizismus nach engl. „go that extra mile“): seine persönlichen Grenzen hinausschieben; mehr leisten als erwartet oder gefordert wird.
Die Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter müssen in ihrer Ausbildung diese „Extrameile“ im literalen, aber ebenso im übertragenen Sinn gehen. Neben dem Weg war ihnen eine Gemeinschaftsaufgabe aufgegeben worden: 2000 Liegestützen und 2000 Kniebeugen mussten ebenso absolviert werden. So wurde der Weg durch die fränkische Winternacht immer wieder von zusätzlichen sportlichen Übungen unterbrochen und so mancher Muskel noch mehr belastet. Doch meine Lehrgruppe nahm dies nicht nur tapfer hin, sondern setzte die Aufgabe motiviert durch die sonore Ansage eines ihrer Kollegen um.

Die Extrameile.
Ein biblisches Motto, das auch mich durch so manche dienstliche Herausforderung und Aufgabe trägt. Der Kontext, aus dem Jesus Seine Worte schöpfte ist kein einfacher, denn hier geht es um ein feindlich gesinntes Umfeld und Vergeltung, auf die ein Nachfolger und eine Nachfolgerin im Falle einer Auseinandersetzung verzichten sollten. Hier sagt er:
Ihr habt gehört, dass gesagt ist ( 2. Mose 21,24) : »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt , so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will.
Mt 5,38-41
Die Rede der Extrameile hat über christliche Gemeinschaften im angloamerikanischen Raum ihren Eingang auch in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Das „Neue Testament Jüdisch erklärt“ beschreibt den durchaus bedenkenswerten Hintergrund dieser Redewendung in folgender Weise:
Eine Meile, römische Soldaten hatten das Recht, Einheimische einzuziehen, damit diese ihre Ausrüstung für eine Meile trugen: Die zusätzliche Meile verdeutlicht die fehlende Gegenwehr.
Neues Testament Jüdisch erklärt, S. 26.

In der Ausbildung müssen Auszubildende diese Extrameile gehen, wenn es sich hierbei auch nicht um einen feindlichen, sondern einen selbstgewählten Kontext und damit den zu beschreitenden Ausbildungsweg zum Wunschberuf handelt.
Aber nicht nur sie gehen diese Extrameile. Auch ihre Ausbilderinnen und Ausbilder, sowie alle, die für ihren Lernweg das Notwendige bereitstellen. Das merkte ich in dieser Nacht als Seelsorgerin ebenso während das Gewicht meines Rucksacks dessen Riemen in meine Schultern drückten und ich dem langsam hereinbrechenden Tag sehnsuchtsvoll entgegenlief. Immer wieder bin ich beeindruckt von dem Engagement derer, die für die bundespolizeiliche Ausbildung sorgen. Angeführt von ihrem Lehrgruppenleiter PHK Ralf Obermaier hatte mich die Lehrgruppe nicht nur herzlich in ihrer Mitte aufgenommen, sondern mich dies miterleben und durchleben lassen. Stringenz, Teamgeist, Durchhaltevermögen. Schritt um Schritt brachten diese die Lehrgruppe zu ihrem Ziel durch die dunkle Nacht.

Die Extrameile.
Endlich lag diese und viele andere (genauer gesagt laut Fitnessuhr 21 km) hinter mir. Ich atmete durch und genoß die spektakuläre Aussicht am Staffelberg. Welch ein Segen Teil ihrer polizeilichen Ausbildung sein zu dürfen. Sie begleiten zu dürfen in dunklen Zeiten der Herausforderung und hellen Freudenmomenten.

Lieber Blogleser, liebe Blogleserin: Jesus sagt: „Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“ Als Polizeiseelsorgerin ist mein Herz voll nach einer solchen Alarmübung, mein Mund geht über und meine Finger fliegen über die Tasten meines Mac-Books während ich diesen Blog schreibe.
Ich wollte Sie an diesem wichtigen Bestandteil bundespolizeilicher Ausbildung teilhaben lassen, damit auch Sie die Extrameile gehen und für unseren Nachwuchs tun, was möglich ist. Das Gebet wäre einer dieser Möglichkeiten, die auch in der Ferne leicht möglich sind. Gegenwärtig geht mein Blick vor allem in Richtung unseres polizeilichen Nachwuchses, da ich für sie mitverantwortlich bin. Beten Sie für deren schwere Aufgaben, die sie zu meistern haben. Aber beten Sie auch für den Nachwuchs anderer Berufsgruppen – ob Kirche, Gesellschaft oder Politik. Sie alle sind unsere Zukunft und brauchen unsere verlässliche, ermutigende, manchmal mahnende, aber auch richtungsweisende Begleitung, damit sie zum Ziel ihres Wunschberufes gelangen. Aus meiner Sicht als Seelsorgerin benötigen sie vor allem Gottes ständige Präsenz, damit sie in der Dunkelheit ihres Dienstes den Weg und ihre Aufgaben meistern, um mit dem angebrochenen Tag zu noch größerer Stärke und Verantwortung zu gelangen.